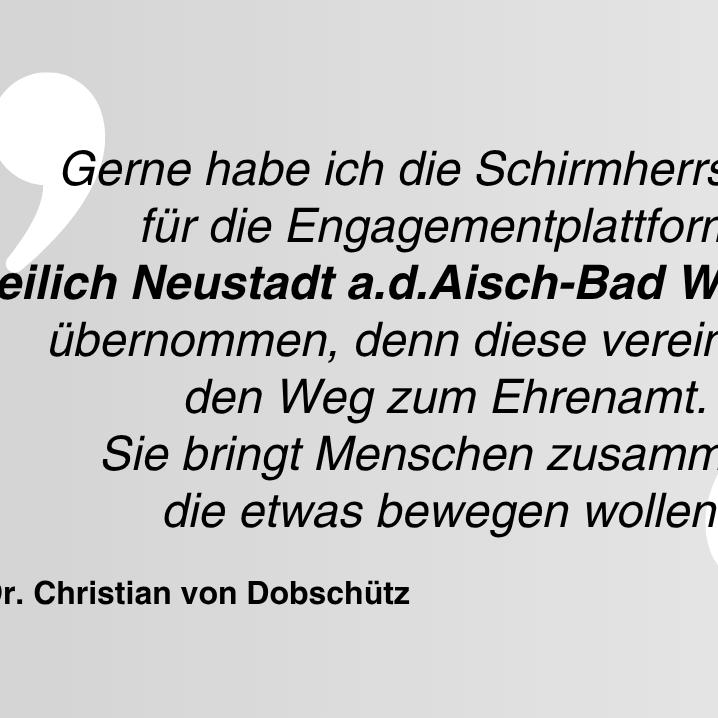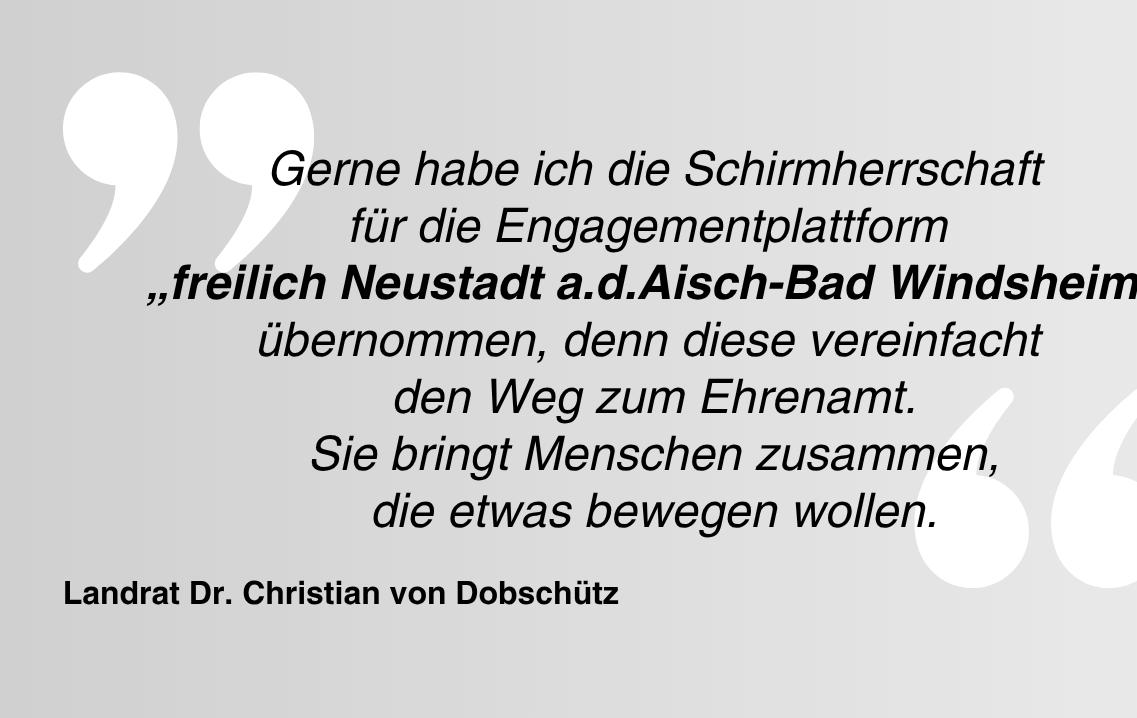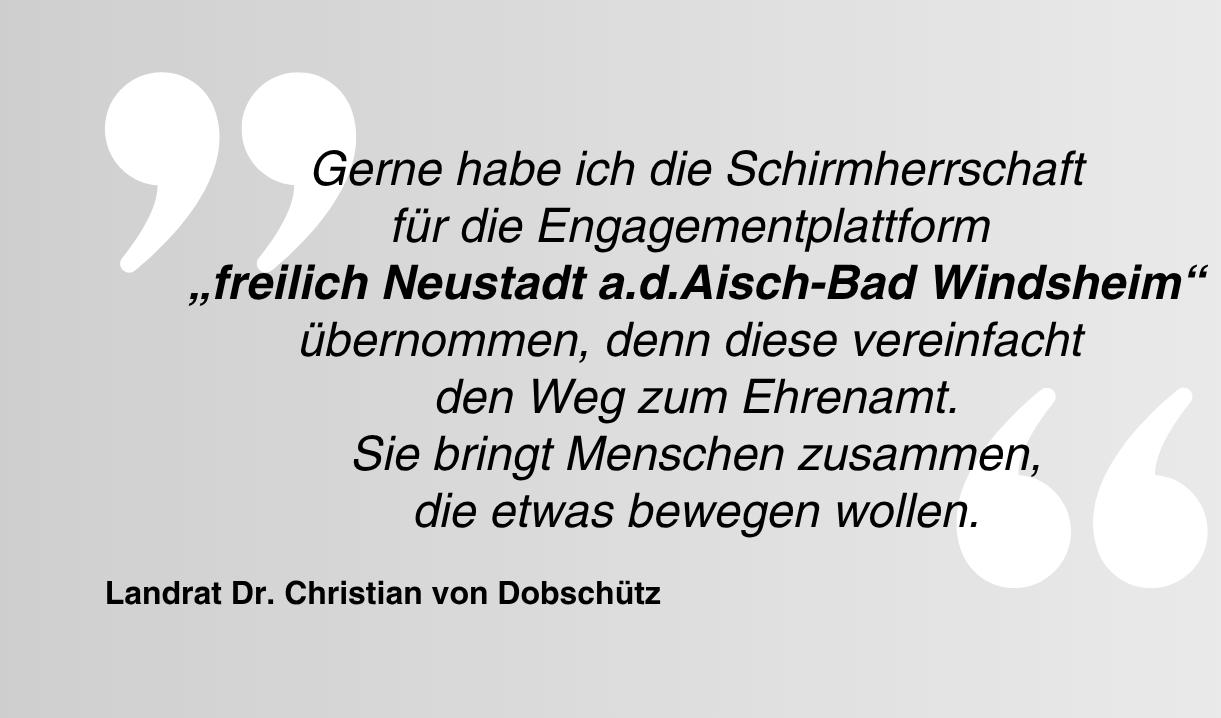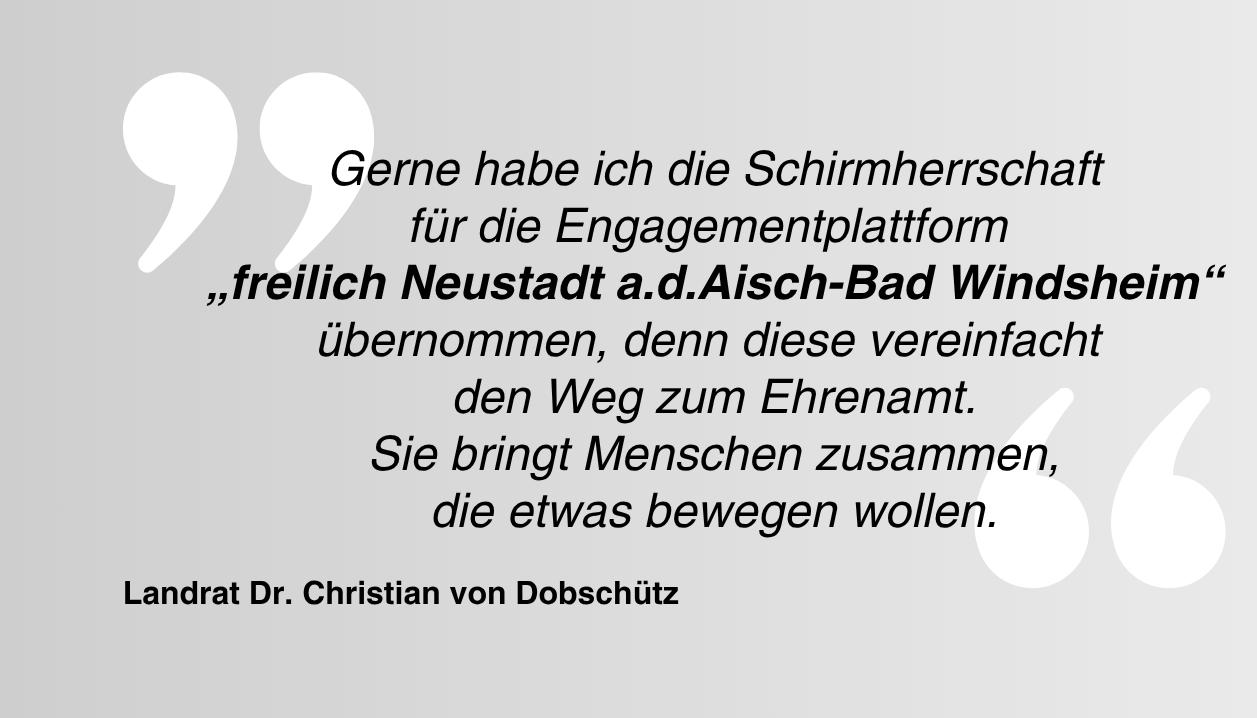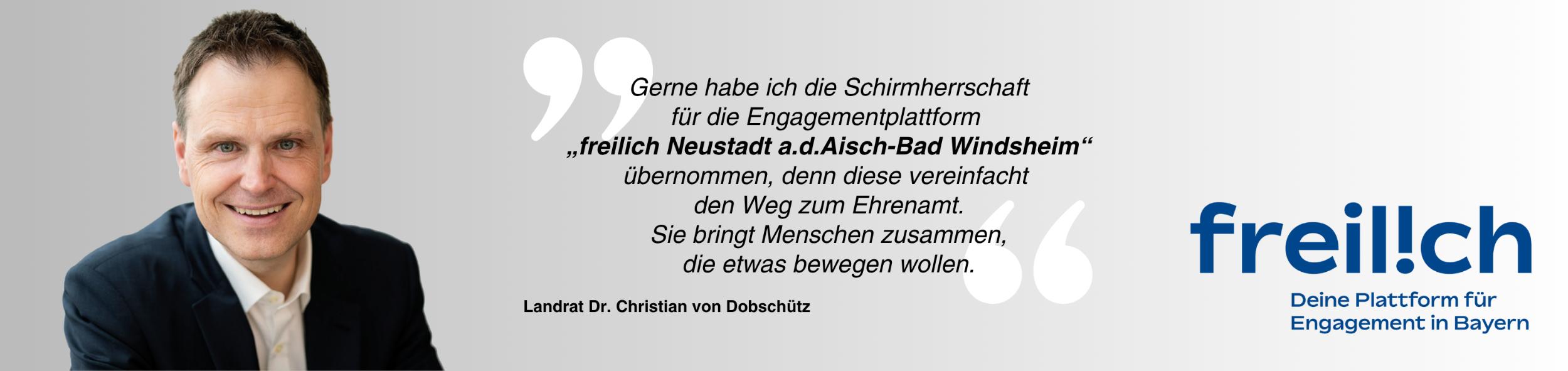Viele fleißige Hände packen unermüdlich mit an, um Geflüchteten das Ankommen und die Integration zu erleichtern. Ob gespendete Kleidung sortieren, Deutsch unterrichten, gemeinsame Begegnungen organisieren oder Möbel beschaffen – die Liste der Hilfsdienste ist endlos. Wird Hilfsbereitschaft in die Tat umgesetzt, gerät häufig aus dem Blick, wer den Helfern hilft, wenn ihnen etwas zustößt.
Generell ist das Thema Versicherung nicht problematisch. In ganz vielen Fällen genießen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer Versicherungsschutz.
Voraussetzungen für gesetzlichen Versicherungsschutz
Wie bei anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten erhalten auch „Flüchtlingshelfer“ automatisch und kostenlos den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung - wenn sie gewisse Voraussetzungen erfüllen.
Fünf Kriterien müssen erfüllt sein, damit das Ehrenamt „amtlich“ ist. Es muss
- freiwillig erfolgen
- unentgeltlich ausgeübt werden
- regelmäßig erfolgen
- organisiert sein
- anderen Menschen zu Gute kommen.
Zu den Voraussetzungen zählt also, dass die Mithilfe über die Kommune oder Wohlfahrtsverbände organisiert sein muss. Heißt also, Einsätze und -orte werden von diesen festgelegt, die Verantwortlichen verteilen die Aufgaben, übernehmen Einteilung sowie Koordination. Optimalerweise unterzeichnen die ehrenamtlichen Helfern eine Ehrenamtsvereinbarung. Sie verifiziert den ehrenamtlichen Einsatz und bietet gleichzeitig Sicherheit in Sachen Datenschutz.
Achtung!
Wer hingegen spontan Kleidung, Spielzeug oder Lebensmittel an Bahnhöfe oder in Flüchtlingsunterkünfte bringt, handelt privat. Diese Eigeninitiative wird nicht durch den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gedeckt, den organisierte ehrenamtliche Helfer genießen.
Für Initiativen, die keine Rechtsform haben und somit keinen Versicherungsschutz bieten, kann es hilfreich sein, die eigenen Tätigkeiten in einen größeren Verband, wie beispielsweise der Caritas, Diakonie oder AWO, anzubinden. Diese verfügen in der Regel über Haftpflicht- und Unfallversicherungen für die Engagierten, so dass Ehrenamtliche im Schadensfall nicht befürchten müssen, auf ihren Kosten sitzen zu bleiben.
Leistungsumfang und Subsidiarität
Verletzt sich ein ehrenamtlicher Helfer während eines Einsatzes, aber auch auf dem Hin- oder Rückweg zwischen Einsatz- und Wohnort, springt die gesetzliche Unfallversicherung ein.
Für den Schaden, den ein Engagierte einer anderen Person zufügt, haftet in der Regel die Trägerorganisation bzw. deren Haftpflichtversicherung.
Neben all diesen Leistungen aus gesetzlichen Versicherungen springen auch gegebenenfalls privat abgeschlossene Versicherungen – Unfall- oder Berufsunfähigkeitsversicherung – ein.
Zudem haben fast alle Bundesländer private Unfall- sowie Haftpflicht-Sammelversicherungsverträge abgeschlossen wie z. B. die Bayerische Ehrenamtsversicherung. Falls also für die Tätigkeit kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz vorgesehen ist, die Vereinigung keine private Unfallversicherung für Ehrenamtliche abgeschlossen hat und auch selbst keine Unfallversicherung besteht, sind Ehrenamtliche über die Unfallversicherung des Freistaates Bayern geschützt.
Achtung!
Prinzipiell gilt jedoch für Haft- und Unfallversicherung: Der gebotene Versicherungsschutz ist nachrangig (subsidiär), d.h. eine anderweitig bestehende Haftpflicht- oder Unfallversicherung (gesetzlich oder privat) geht im Schadensfalle der Landesversicherung vor.
Darauf sollten Sie im Schadensfall achten
Zwischen den Versicherungsträgern existieren bestimmte Abkommen, die die Zuständigkeiten regeln. Wichtig ist, bei der ärztlichen Erstbehandlung, die ehrenamtliche Tätigkeit und den Ort der Verletzung anzugeben, damit der Arzt oder das Krankenhaus die Unterlagen an die zuständige Stelle weiterleiten können.
Sofern über den Träger eine Unfall- und/oder Haftpflichtversicherung besteht, soll der Unfall auch bei der Stelle, für die Person ehrenamtlich tätig ist, gemeldet werden.
Haftpflicht von Asylbewerbern
Asylbewerberinnen und Asylbewerber sind in der Regel nicht haftpflichtversichert. Sollte es zum Schaden am Eigentum von Ehrenamtlichen kommen, sind Asylbewerber grundsätzlich persönlich zum Ausgleich verpflichtet.
Aufgrund der geringen finanziellen Mittel wird in einem solchen Fall oft Ratenzahlung vereinbart.
In Einzelfällen übernimmt das Sozialamt die Kosten von Schäden, die durch Geflüchtete verursacht werden, insofern kein Vorsatz vorliegt. Bei Schäden an der Unterkunft trägt für gewöhnlich der Betreiber das Risiko.